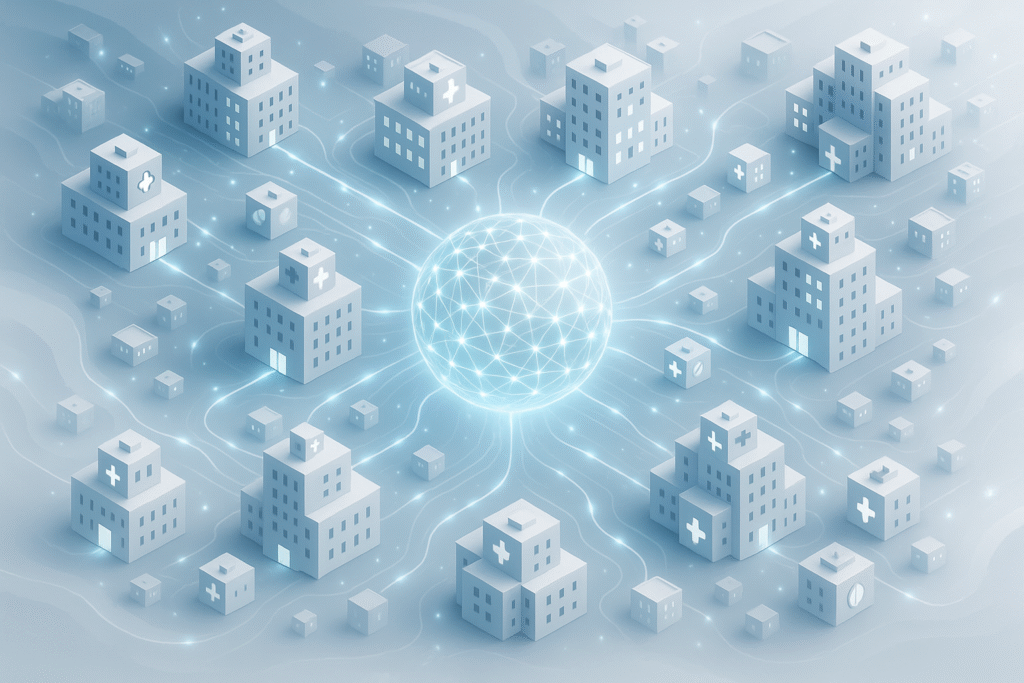Künstliche Intelligenz wird die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern, vor allem weil sie einige Chancen und Fähigkeiten mit sich bringt, die ein Mensch nicht hat und nicht haben kann. KI soll medizinisches Personal nicht ersetzen, aber so unterstützen, dass Diagnosen präziser, Dokumentation automatisiert und Ressourcen besser geplant werden. Dafür braucht die KI hochqualitative Daten. Denn die Qualität der Daten ist ein entscheidendes Maß, wie gut die Resultate oder Ergebnisse sind, die die KI aus den Daten ausarbeiten kann.
Einige Gesundheitseinrichtungen halten KI für strategisch wichtig, aber geringfügige Datenqualität und fragmentierte Datenstrukturen, die die Datenverfügbarkeit behindern, beeinflussen den Einsatz massiv. Um es mit anderen Worten auszudrücken: „Die Qualität und Performanz, mit der KI-Modelle und -Systeme klassifizieren, prognostizieren und Inhalte generieren, stehen und fallen mit der Qualität“ der verwendeten Daten. Und dieses Prinzip greift sowohl bei Test- und Trainingsphasen einer KI als auch im operativen Betrieb. Für IT-Verantwortliche im Krankenhaus heißt das, Datenqualität und Datenverfügbarkeit sind entscheidend, wenn es darum geht, das volle Potenzial von KI im Krankenhaus zu nutzen.
Datenchaos im Klinikalltag und warum viele KI-Projekte ins Stolpern geraten
Unstrukturierte Daten
KI kann die Daten, wie sie oft noch in Kliniken vorliegen, nicht oder nur schwer nutzen. Patientendaten liegen oft noch verstreut in Krankenhausinformationssystem (KIS), in Labor- oder Radiologiesystemen oder anderen Dokumenten. Meist fehlen auch noch Standards für den Datenaustausch und Insellösungen machen das Ganze nicht einfacher, denn Datensilos bremsen den Einsatz von KI aus.
Typische Probleme sind unstrukturierte Formate. Beispielsweise wenn Befunde oder Arztbriefe noch als Freitext verfasst oder als Scan/PDF per E-Mail verschickt werden, denn „[…]Scans oder Handyfotos lassen sich nicht als strukturierte Daten in die Kliniksysteme überführen“. Und was nicht strukturiert erfasst ist, können KI-Systeme kaum nutzen. Beispielsweise kann ein KI-Modell nicht die Gesamtsituation eines Patienten analysieren, wenn Patientendaten über mehrere Systeme fragmentiert sind. In deutschen Krankenhäusern werden jährlich circa 150 Millionen Arztbriefe geschrieben, aber viele davon werden immer noch manuell oder nicht-interoperabel gespeichert. Wie soll KI diese Daten dann nutzen können?
Datenmenge und Datenvollständigkeit
Natürlich spielt auch die Datenmenge und -vollständigkeit eine Rolle dabei, wie effektiv eine KI arbeiten kann. Gerade in der Diagnostik beeinflussen Umfang und Qualität der Daten die Genauigkeit der KI-Ergebnisse und das natürlich bereits beim Training einer KI. Das Fraunhofer Institut für Kognitive Systeme (IKS) betont, dass die Datenbasis die Güte eines KI-Systems maßgeblich beeinflusst und der zeitaufwändigste Teil eines KI-Projekts sei.
Wenn KI lückenhafte oder fehlerhafte Daten nutzt, lernt sie die falschen Muster oder kann die Daten nicht richtig interpretieren. Welche Auswirkungen das beispielsweise auf die Qualität der Interpretation der Ergebnisse bildgebender Verfahren haben kann, mag man sich nicht vorstellen. „Unsicherheit und Bias sind häufig Resultate von Training auf unvollständigen oder ungenauen Daten“, warnt Fraunhofer IKS, und das führt zu unsicheren und potenziell verzerrten Resultaten. Ein anderes Beispiel lässt sich in der Früherkennung kritischer Zustände finden. Wenn Labordaten fehlen oder falsch erfasst sind, kann ein KI-Algorithmus zur Früherkennung Sepsis-gefährdeter Patienten gar nicht richtig funktionieren. Die Datenbasis, mit der KI trainiert wird, aber auch die, mit der sie agiert, ist entscheidend, um tragfähige Ergebnisse zu liefern.
Strukturierte und einheitliche Daten sind der Schlüssel für erfolgreiche KI im Krankenhaus
Die Lösung für das oben geschilderte Problem wird also klarer: Es braucht strukturierte, einheitliche und leicht zugängliche Daten. Strukturierte Daten in Form klar definierter Einträge, Codes oder Formate machen es der KI überhaupt erst möglich, sinnvoll darauf zuzugreifen, sie auszuwerten und Muster zu erkennen.
Wesentlich ist dabei auch die Interoperabilität der IT-Systeme. Klar müssen die Daten strukturiert sein, aber sie müssen auch verständlich kommuniziert werden können. „Interoperabilität statt Datensilos“ lautet daher die Devise. Der Aufwand, HL7FHIR oder IHE-Protokolle zahlt sich aus. Denn standardisierte Schnittstellen machen einen flüssigen und sicheren Datenfluss KIS, Labor und Radiologie und anderen Bereichen möglich. Interoperable, strukturierte Daten bilden die Grundlage dafür, in einer weiteren Ausbaustufe KI in den Behandlungsprozess einzubeziehen. Vereinfacht gesagt: Erst wenn die Systeme miteinander kommunizieren können, kann eine KI mithören und unterstützen.
Beispielsweise zielt die Telematikinfrastruktur, koordiniert von der gematik, mit der elektronischen Patientenakte (ePA) darauf ab, einheitliche und strukturierte Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Und sobald Patienteninformationen zentral und standardisiert vorliegen – egal ob Medikationspläne oder Bilddaten- können KI-Anwendungen diese Daten viel leichter verarbeiten.
Datenbasis als entscheidender Faktor
KI kann in vielen Bereichen eines Krankenhauses hilfreich sein. Aber egal, ob es um Spracherkennung, Entscheidungsunterstützung oder Prozessoptimierung geht, all diese KI-Systeme stehen und fallen mit der Qualität der Daten, die ihnen zur Verfügung stehen.
Wenn relevante Informationen unvollständig, uneinheitlich oder gar nicht erst digital erfasst sind, kann eine KI nicht sinnvoll analysieren oder Vorschläge machen. Das betrifft sowohl die initiale Entwicklung und das Training von KI-Modellen als auch ihren Einsatz im Versorgungsalltag. Um verlässliche Zusammenhänge zu erkennen, braucht sie auch im Betrieb aktuelle, gut strukturierte und interoperabel verfügbare Daten.
Was jetzt?
Was kann man aus diesen Informationen jetzt ableiten? CIOs und IT-Leitungen sollten jeden Plan zur Einführung von KI zunächst als Datenprojekt betrachten. Das heißt konkret, Datensilos aufzubrechen, Datenflüsse analysieren, Standards implementieren und konsequentes Datenmanagement zu betreiben.
Das ist natürlich nicht alles auf einmal umsetzbar. Aber die elektronische Patientenakte einzuführen, HL7 FHIR umzusetzen oder Altbestände zu bereinigen sind alles wichtige Schritte. Und zwar nicht nur, aber auch für den erfolgreichen und sinnvollen Einsatz von KI in Krankenhäusern. Klar sind das technische Voraussetzungen, aber sie helfen auch dabei, Vertrauen bei Personal und Patienten zu schaffen. Denn durch strukturierte, einheitliche und zugängliche Daten schafft man die Grundlage für den KI-Einsatz im Krankenhaus und stärkt das Vertrauen in die Ergebnisse einer KI und eine neue Form der medizinischen Versorgung, die Daten zum Wohle der Patienten intelligent nutzt.